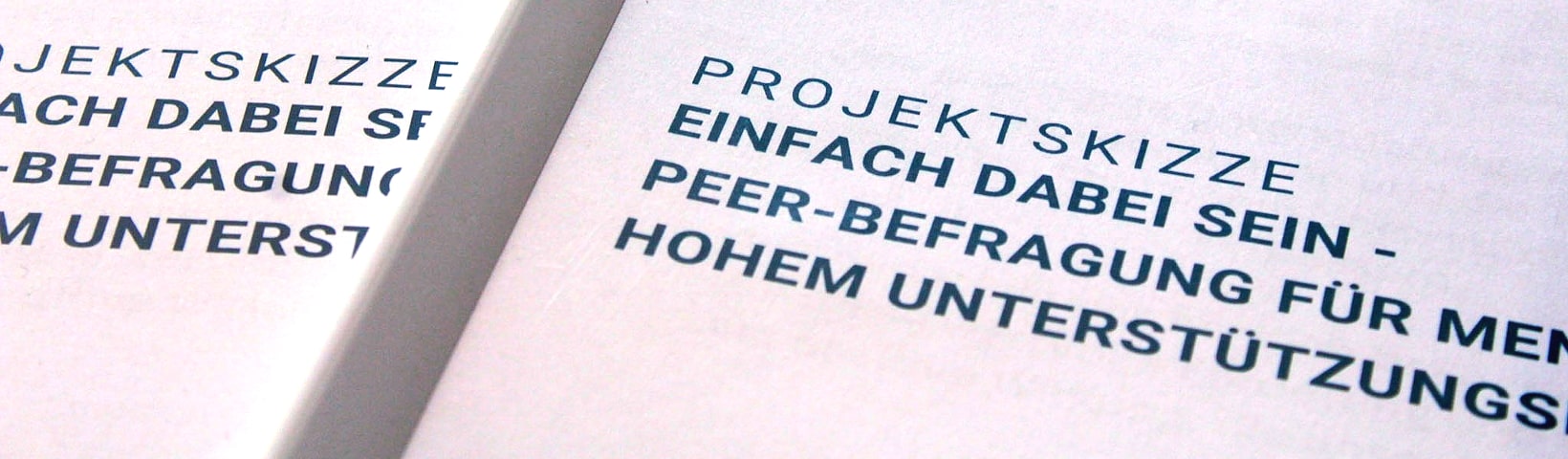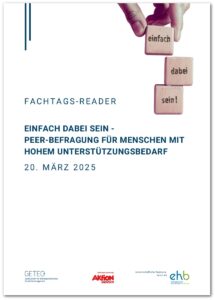Fachtag »Einfach dabei sein«
Peer-Befragung für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf
In Zusammenarbeit mit Peers, Fachexpert*innen und einer wissenschaftlichen Begleitung entwickelt die GETEQ im Rahmen des von Aktion Mensch geförderten Projekts »einfach dabei sein« eine Erhebungsmethode, die Partizipation von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf stärkt und eine direkte Mitbestimmung dieser Zielgruppe ermöglicht.

Der Tag
Am 20. März 2025 lud die GETEQ zu einem Fachtag im Rahmen des von Aktion Mensch geförderten Projekts »einfach dabei sein« ein – eine wertvolle Gelegenheit für die zahlreichen Teilnehmenden, sich intensiv mit dem Thema Teilhabe insbesondere für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf auseinanderzusetzen, sich auszutauschen sowie neue Perspektiven und Impulse für die Praxis zu gewinnen.
Als Auftakt erhielten die Teilnehmenden spannende Einblicke in die Ziele und Hintergründe des Projekts und waren eingeladen, ihre eigenen Erfahrungen und Perspektiven einzubringen. Nach einführenden Beiträgen wissenschaftlicher Expert*innen kamen die Teilnehmenden anschließend in Austauschrunden miteinander ins Gespräch, entwickelten Ideen und brachten eigene Fragen ein. Diese Phase war geprägt von engagierten Diskussionen und inspirierenden Sichtweisen.

Zum Abschluss fassten die Moderator*innen die wichtigsten Erkenntnisse des Tages zusammen und gaben einen Ausblick auf mögliche nächste Schritte. Der Fachtag zeigte eindrucksvoll, wie wichtig der gemeinsame Austausch und die Vernetzung für eine inklusive Gesellschaft sind. Wir danken allen Beteiligten für ihre wertvollen Beiträge und freuen uns darauf, die gewonnenen Impulse weiterzutragen!
Hintergrund des Projekts
Die GETEQ führt seit Jahren Evaluationen auf Peer-Ebene in Einrichtungen der Behindertenhilfe durch, um die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern. Bisher wurde dabei die »Peer-Beobachtung« eingesetzt. Dieses Instrument erlaubt jedoch nur eine stellvertretende Einschätzung, anstatt Betroffenen selbst eine aktive Stimme zu geben.
Gesetzliche Neuerungen wie das Bundesteilhabegesetz und das Berliner Wohnteilhabegesetz verpflichten zu Peer-Befragungen, erlauben jedoch Ausnahmen für Menschen die »nicht zur Willensäußerung im Stande sind«. Dies könnte ihre Mitbestimmung einschränken und birgt das Risiko, dass gerade Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf von Mitbestimmungsprozessen ausgeschlossen sind. Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert gleichberechtigte Teilhabe – daher müssen Befragungsmethoden weiterentwickelt werden, um Kommunikationsbarrieren abzubauen.
Bisherige Beobachtungsverfahren erfassen häufig nur objektive – also von außen beobachtbare – Abläufe, während persönliche Perspektiven und Erfahrungen unzureichend berücksichtigt werden. Bei der Entwicklung des neuen Instruments stellen wir daher folgende Fragen ins Zentrum:
- Welche Kommunikationsmethoden eignen sich am besten für die Befragung von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf?
- Welche Methoden sind spezifisch genug und gleichzeitig in einem breiten Spektrum anwendbar?
Unser Projekt orientiert sich am sogenannten funktionalen Verständnis von Behinderung, bei dem Barrieren zwischen Individuum und Umwelt im Fokus stehen. Wir wollen damit Kommunikationshürden abbauen und Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf nicht von vornherein die Fähigkeit zur Willensäußerung absprechen. Mit »Einfach dabei sein« soll nicht nur die direkte Mitbestimmung von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf verbessert, sondern auch das Peer-Evaluationsverfahren weiter professionalisiert und für die Zukunft gestärkt werden.

Die Beiträge
Partizipation gestalten – Wo stehen wir in Deutschland und Berlin?
Prof. Dr. Michael Komorek von der Evangelischen Hochschule Berlin gab einen wissenschaftlichen Impuls zur aktuellen Teilhabe-Situation in Deutschland und Berlin. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf besser einbezogen werden können.
Dabei wurden zentrale Ansätze zur Stärkung von Inklusion und Partizipation hervorgehoben, darunter eine stärkere Sozialraumorientierung, der Einsatz wirksamer Methoden zur Partizipationssteigerung und die bedarfsgerechte Unterstützung anhand der ICF-Kriterien (Funktionale Gesundheit).

Eine Erhebung zur Umsetzungsqualität zeigte Herausforderungen in der Bedarfsermittlung: Viele Betroffene sehen sich gezwungen, möglichst viele Ziele zu benennen, um notwendige Hilfen zu erhalten, während gleichzeitig die Sorge besteht, bei Nichterreichung Leistungen zu verlieren. Gewünscht wird eine gezieltere Beratung, um passgenaue Eingliederungshilfen zu erhalten. Zudem erweist sich die Übertragung der Bedarfsfeststellung in finanzielle Leistungsbeschreibungen als komplex.
Auch die Rolle der Leistungserbringer*innen wurde beleuchtet: Neben ihrer Expertise in der Begleitung von Menschen mit komplexen Unterstützungsbedarfen spielen sie eine Schlüsselrolle in der bedarfsgerechten Unterstützung. Wichtige Aspekte sind hierbei die Entwicklungsberichterstattung nach ICF-Kriterien, der Aufbau landesweiter Qualitätsstandards und das Empowerment der Leistungsberechtigten – insbesondere bereits vor der Hilfebedarfsfeststellung.

Partizipation visuell denken – Methodische Ansätze und Ergebnisse der Machbarkeitsstudie
Dr. Annika Lang von der Ludwig-Maximilians-Universität München präsentierte die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie im Rahmen des Projekts. Zudem stellte sie die partizipative Forschungsmethode »Photo Voice« vor und erläuterte ihre theoretischen und praktischen Grundlagen.
Die Machbarkeitsstudie untersuchte die methodische Umsetzbarkeit, die Nachhaltigkeit eines Erhebungsinstruments und mögliche Risiken. Zu den zentralen Empfehlungen gehören die konsequente Partizipation aller Akteur*innen, um eine möglichst inklusive und bedarfsgerechte Umsetzung zu gewährleisten. Der Einsatz kreativer und partizipativer Methoden, eine kollaborative Auswertung sowie die Nutzung digitaler und multimethodischer Ansätze werden als essenziell für den Erfolg des Instruments angesehen. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass die Zufriedenheitsbefragung flexibel, anpassbar und für unterschiedliche Zielgruppen zugänglich bleibt.

Als Beispiel stellte Dr. Annika Lang die Methode »Photo Voice« vor, die den Teilnehmenden ermöglicht, ihre Lebensrealität durch Fotos darzustellen, die anschließend gemeinsam reflektiert und interpretiert werden. Diese Methode bietet insbesondere Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf eine niederschwellige Möglichkeit, ihre Perspektiven auszudrücken. Durch visuelle Kommunikation wird die Selbstbestimmung gestärkt und ein besseres Bewusstsein für ihre Lebenswelten geschaffen. »Photo Voice« fördert Empowerment und Inklusion, da sie flexibel an die Bedürfnisse unterschiedlicher Personengruppen angepasst werden kann.
Zum Nachlesen: Der Fachtags-Reader
Hier zum Download des Fachtags-Readers [pdf 1,8 MB / 37 Seiten] mit den Präsentationsfolien von Prof. Dr. Michael Komorek und Dr. Annika Lang.